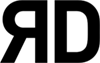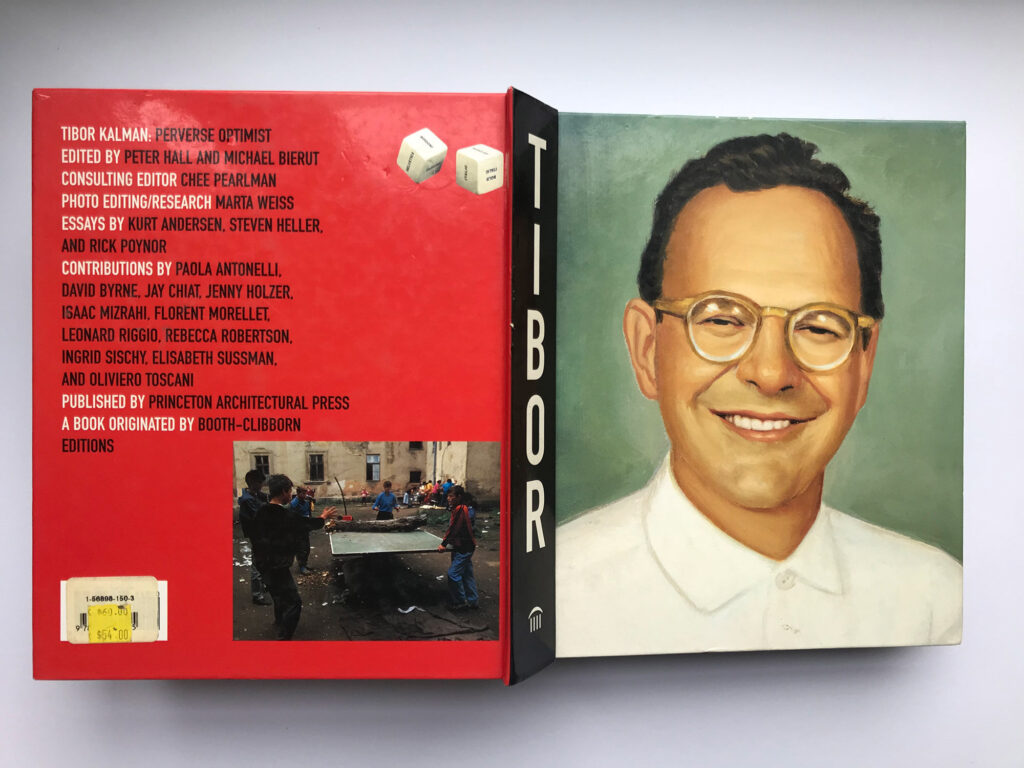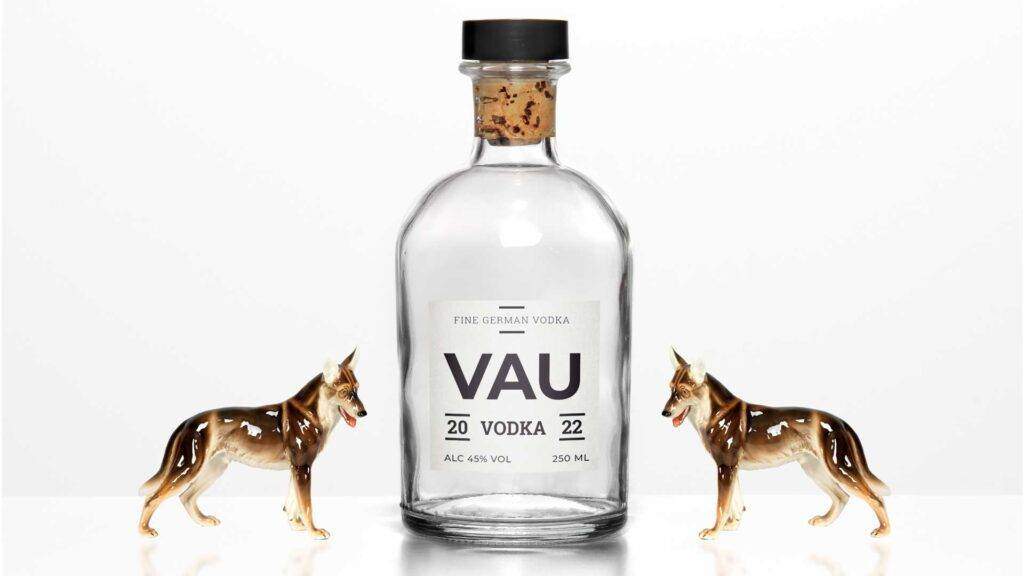Warum viele Websites keine Kundenbindung erzeugen – und was Sie besser machen können
Viele Websites hören genau da auf, wo Kundenbindung eigentlich beginnt: nach dem Auftrag. Dabei lässt sich mit einer einfachen Bewertungsseite nicht nur wertvolles Feedback sammeln, sondern auch verhindern, dass Frust auf Google landet. Wie das funktioniert – und warum es besonders für Handwerker und Dienstleister sinnvoll ist, lesen Sie hier.